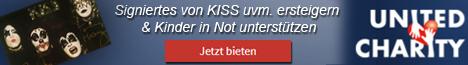Aber von vorne. Musik war immer etwas, das seinen festen Platz hatte, Aufwand und Planung bedeutet hat. Kassette, CD und MP3 sind die Formate, mit denen ich groß geworden bin. Alle brauchten spezielle Geräte, keins so praktisch, klein und sowieso dabei wie das Smartphone. Alle mussten irgendwo herkommen und brauchten Platz, physisch oder auf der Platte. Musik war nicht einfach da, Musik war aufwendig. Das war der Unterschied zwischen Musik hören und Radio hören.
Streaming und das versteckte Problem
Und dann kam Streaming (allgemein, denn ich habe die meisten Anbieter durch) und alles war immer da. Es gab nichts mehr, das man planen musste, nichts mehr, über das man sich Gedanken machen musste, nichts mehr, das man vermissen konnte. Ein musikalisches Schlaraffenland ohne das schlechte Gewissen von Tauschbörsen oder anderem daheim Gebrannten. Langsam und schleichend verschwanden mein Spaß am Musikhören, mein Gefühl, einen Geschmack zu haben, und das Bedürfnis, in neue Sachen einzutauchen.
Dazwischen gab es kurze Phasen, die waren wie früher: wenn ich den Streamingdienst gewechselt habe, wenn ich ein Album für eine Rezension kritisch gehört habe, wenn ich in neu entdeckte Bands eingetaucht bin. Immer wenn ich mir selbst die Musik als Aufgabe gesetzt habe und wenn es meine Entscheidung war, was ich höre.
Und ein paar Tage später war meine kurze Phase der Entscheidung im Interface hinter Mixen, New Releases, Hot Playlists und anderem Kram verschwunden. Mit dem unterschwelligen Gefühl, dass mit der Priorität des Algorithmus mein individueller Geschmack in den Hintergrund rutscht, haben sich andere Dinge verändert.
Es wurde unnötig, mir zu überlegen, was ich hören möchte, die kurze Phase der Introspektion, wonach mir gerade wirklich ist, war sinnlos geworden. Es warten Vorschläge für jede Stimmung, alles leichter zu erreichen als etwas Bestimmtes zu suchen. Die Geduld, eine Weile zuzuhören, vorfreudig im Album das Lieblingslied zu erwarten, sich auf die Stimmung und die Dramaturgie eines Albums einzulassen, war verschwunden. Der Skip-Knopf bringt ewig Neues und anderes in der endlosen "smarten" Playlist. Mit dem ersten Gefühl von Langeweile kann man etwas Neues haben, signalisiert Spotify, man sollte etwas Neues haben.
Mit dem Versprechen der persönlichen, algorithmischen Kuration ist der Zwang verloren gegangen, sich mit der Musik auseinanderzusetzen. Mit dem Versprechen, dass alles immer verfügbar ist, fällt es schwer, mit dem zufrieden zu sein, was man hört.
Früher war theoretisch auch alles verfügbar, aber eben nicht umsonst. Und das meine ich nicht finanziell. Es kostete Zeit, zu suchen (im Laden, bei Freunden, auf den Sieben Meeren und später bei Amazon), Platz im Regal und auf der Festplatte waren nötig. Zusammenzustellen, was unterwegs dabei sein durfte, war aufwendig. Immer die Entscheidung, ob es mir den Aufwand wert ist, das jetzt zu hören. Eine neue CD für unterwegs brennen oder den MP3-Player neu bestücken war nichts, was man ungeplant beim Frühstück konnte.
Bei Spotify und Co war ich an keine Entscheidung gebunden, alles ist jederzeit gleich weit weg. Die Musik ist nicht mehr allein meine Entscheidung, sondern einfach Content, den der Algorithmus mir auf die Startseite spült. Vor Streaming haben die vielen Entscheidungen, die ich über meine Musik treffen musste, meine eigene Sammlung zu etwas gemacht, das persönlichen Wert hatte. Ein Testament des eigenen Geschmacks, Zeuge persönlicher Entwicklung und eine Fundgrube alter Erinnerungen. Es ist schwer, für eine Sammlung aus losen Daumen und Sternchen in einer Streaming App das Gleiche zu empfinden.
Meine Lösung
Erst als ich angefangen habe, meine Online-Dienste (besonders die aus den USA) so weit es geht durch selbstgehostete Lösungen zu ersetzen, habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Warum dann nicht auch meine Musik? Ich war mit Streamingdiensten noch unzufriedener als mit Google Drive und Co.
Also habe ich mir mit Navidrome eine eigene Streaming-Lösung für meine neue Sammlung aufgesetzt. Das ist ein Server mit einem relativ breit unterstützten Streaming-Protokoll, das es mir erlaubt, meine Sammlung auf Smartphone, PC und Browser zu hören, ohne mich überall um Dateien kümmern zu müssen. Bei der Sammlung habe ich effektiv von null angefangen. Was digital noch da ist, ist Kraut und Rüben, und was physisch noch da ist, ist mir wichtig genug, dass ich den Bands das Geld für eine frische, digitale Kopie gerne nochmal gebe.
Mein neues Hören und Sammeln
Da, wo ich höre, kann ich jetzt nichts mehr entdecken, was ich nicht vorher da abgelegt habe; und da, wo ich neue Musik suche, versuche ich nicht mehr, in Ruhe zu hören. Da, wo ich kaufe und stöbere, bin ich frei. Ich muss nicht sorgfältig sein und es nicht ernst meinen. Irgendwann mal reinhören zu wollen hat nicht mehr den gleichen Wert wie die Absicht, zu hören. Denn meine Favoriten, Wunsch- und Merklisten sind nicht mehr das, was ich sehe, wenn ich Musik hören will.
Damit ein Album im Player auftaucht, braucht es mehr als einen Klick. Das Hören funktioniert dann ähnlich praktisch wie bei Spotify, aber bis dahin waren es einige Klicks und eine Kreditkarte, die im Weg standen.
Wenn ich die Mu sik-App oder den DAP in die Hand nehme, sehe ich nur die Sachen, für die ich bereit war, Geld auf den Tisch zu legen. Das sind deutlich weniger Optionen, und zu allen habe ich mir Gedanken gemacht, wann und warum ich sie hören will und wie sie in meine Sammlung passen.
sik-App oder den DAP in die Hand nehme, sehe ich nur die Sachen, für die ich bereit war, Geld auf den Tisch zu legen. Das sind deutlich weniger Optionen, und zu allen habe ich mir Gedanken gemacht, wann und warum ich sie hören will und wie sie in meine Sammlung passen.
Teil des aufwändigeren Prozesses ist auch die Vorfreude. Früher war ein neues Album ein Ritual, verbunden mit Warten, Erwartung, Plastik zum Aufreißen und Booklets zum Blättern. Das Auspacken habe ich durch eine rein digitale Sammlung aufgegeben, aber mit der Möglichkeit, vorzubestellen und dem aufwändigeren Prozess habe ich zumindest einen Teil davon wieder. Neue Alben tauchen nicht mehr einfach zwischen anderen Dingen in New Releases auf, ich muss wieder jagen.
Vorfreude habe ich auch wieder beim Hören. Wo ich früher die App geöffnet habe mit der Erwartung, ziellos zu skippen und zu scrollen, gehe ich heute oft gezielt zu einem bestimmten Album. Ich weiß wieder, was ich will, bevor ich scrolle, weil ich weiß, was mich erwartet. Das Album statt Mix und geshuffelter Playlist ist wieder mein normaler Weg, zu hören. Lieblingssongs sind auch besser, wenn man sich während des Rests des Albums darauf freuen kann.
Zusätzlich bin ich wieder frei, wo und womit ich meine Musik höre. Es gibt diverse Apps und Programme, die von meinem Server streamen können, und noch mehr, die dateibasiert spielen können. Es gibt keinen Digital Audio Player, der nicht Dateien abspielen kann. Ich bin nicht mehr an die Features gebunden, die Streaming-Anbieter wichtig finden, nicht mehr an Hardware, die unterstützt wird. Ich habe so wieder die Kontrolle nicht nur über die Musik, die ich höre, sondern über meine komplette Hard- und Software. Es ist im Vergleich eine Kleinigkeit, aber wieder etwas, das mich drängt, mehr Verantwortung für mein Musikerlebnis zu übernehmen.
Die Sache mit dem Algorithmus und Geschmack
Ein unerwarteter Punkt ist die Befreiung vom versteckten Mehrheitsgeschmack. FLOGGING MOLLY ist die Band, die mich bisher am längsten konstant begleitet hat. Bisher habe ich nur zwei Alben digital nachgekauft: "Speed Of Darkness" und "Life Is Good". Beides persönliche Lieblinge und mir emotional wichtig. Bei YouTube Music tauchen Songs von "Life Is Good" ab Platz 44 auf, "Speed Of Darkness" sieht man erst ab Platz 53 in FLOGGING MOLLYs Top Tracks. Im Algorithmus sind die Alben versteckt. Egal wie viele Sternchen, Herzen und andere Signale: Die beiden sind in keinem Mix für mich zu finden. Meine Sammlung ist wieder meine Sammlung, mit allen Eigenheiten und merkwürdigen Nuancen.
Entdeckung und Empfehlung war immer das große Argument der Abo-Dienste. Es ist das, was statt meiner Sammlung automatisch die Startseite füllt. Als Beispiel ROLO TOMASSI, die eine unerwartete Entdeckung waren. Es gab nie einen Hinweis vom Algorithmus, dass die Band existiert. Drüber gestolpert bin ich bei Bandcamp durch die neue EP, in der Liste mit Neuerscheinungen. Hat es sich gelohnt? Schwer zu sagen, wann mich das letzte Mal Musik so emotional berührt hat. Wenn das das Ziel ist, dann: ja. Über den Algorithmus wäre ich ihnen nie begegnet. Und selbst wenn: Ein einzelner Song ohne Kontext wäre ein sicherer Skip-Kandidat.
Die Themen, die in den Medien sind
Streaming zahlt schlecht. Ehrlich gesagt war das eine nebensächliche Überlegung, bis ich es für den Artikel durchgerechnet habe. Letzter großer Einkauf von einer Band: Drei Alben, insgesamt $ 29. Bandcamp zahlt davon $ 24 an die Band. Bei Spotify wären das etwa 7.000 Streams (Auszahlung fluktuiert), also über 200 komplette Durchläufe pro Album. Wenn ich das auf die 10-15 Jahre aufteile, die das realistisch dauert, wären das um die 1.500-2.000 € an Spotify (ohne zukünftige Preiserhöhungen). Nach dem aktuellen Schlüssel geht das Geld an Spotify und die großen Labels, für die Kleinen bleibt wenig übrig.
Finanziell ist es bisher insgesamt teurer, aber flexibler. Ich hatte jetzt schon Monate, wo ich weniger für Musik ausgegeben habe, als ich für Streaming ausgegeben hätte. Es hat keinen fixen Preis mehr und ich kann mein Budget so anpassen, wie ich möchte. Bei 12 bis 20 Euro für Streaming kein großes Argument, aber heute, wo alle Abos sein wollen, wieder ein kleiner Funke Freiheit und Kontrolle. Ich mag schneller das ausgegeben haben, was ich für die letzten 10 Jahre Streaming bezahlen musste, aber die Musik, die ich kaufe, ist da, auch wenn ich nicht mehr zahle.
Dazu kommt, dass jedes Unternehmen in der Kette eine weitere Schicht potenzieller Skandale ist. Ich finde es immer schwer, Kunst und Künstler zu trennen und noch schwerer, Geld in Richtung von Leuten zu schieben, die ich nicht unterstützenswert finde. Streaming und besonders Spotify bekleckert sich da nicht mit Ruhm: Botting, Unbeteiligte, die beim Versuch, es zu beheben, als Kollateralschaden aus dem Katalog gekickt werden (Link geht zu YouTube), Ghost Artists, um Geld zu sparen.
Bücher wie "Mood Machine", "Filterworld" (beide leider eher mäßig geschrieben) und YouTuber wie Benn Jordan (oben schon verlinkt) oder Venus Theory sind zu kulturellem Einfluss und fragwürdigen Geschäftspraktiken bessere Quellen als ich. Viele der Probleme, die playlistabhängigere Genres plagen, sind im Metal dank Live-Kultur und langlebigen Bands noch nicht so spürbar, aber die Anreizstruktur ist da.
Nachteile
Viele Punkte, die ich positiv sehe, sind Varianten von Verantwortung und Reibung. Sprich: effektiv mehr Arbeit. Für mich der Preis, den ich für die Vorteile bezahle, für jemanden, der meine Probleme nicht hat, vermutlich unnötiger Aufwand.
Die nötige Infrastruktur und Logistik kostet Zeit, Geld und ist ein eigenes Hobby in sich. Ich muss den Server unterhalten und verwalten, das sind ein paar Minuten am Tag und hier und da mal ein paar Stunden. Aber auch bei physischen Sammlungen oder digitalen, die man als Dateisammlung mitnimmt, muss man sich um Lagerung, Sortierung und den ganzen Kram kümmern. Arbeit und Zeit, die einem Abo-Dienste abnehmen.
Ich kaufe meistens auf Bandcamp, Qobuz oder (bei alten und überteuerten Dingen) gebrauchte CDs. Die Haupthindernisse beim Kauf sind vermutlich Folge des Streaming-Primats und beziehen sich auf Verfügbarkeit und Preis: Es gibt gefühlt immer mehr Bands, die lose Singles statt Alben rausbringen. Im Streaming fällt es nicht auf, aber einzelne Titel kaufen wird schnell teuer.
Es gibt auch Bands, denen die Pflege von verschiedenen Kanälen zu aufwendig ist, da kommt dann eher Bandcamp als Spotify unter die Räder. Streaming macht einen Großteil des Umsatzes der Musikindustrie aus, Käufer sind selten geworden. Platten und Streaming sind oft der Hauptfokus, digitale Verkäufe werden eher stiefmütterlich behandelt.
Meine Erfahrung
Insgesamt habe ich für mich Verfügbarkeit durch Verbindung ersetzt. Nichts ist da, was nicht irgendwie zu mir gehört. Es ist nicht mehr Content, es ist wieder meine Musik. Der kleine Teil von Spotifys Millionen Songs, den ich mir zusammengekauft habe, ist in der kurzen Zeit wieder deutlich abenteuerlicher und vielseitiger geworden als alles, was der Algorithmus mir vorgeschlagen hat.
Aktuell besteht meine wachsende Sammlung noch aus mickrigen 80 Alben, aber alle erfahren von Zeit zu Zeit die Liebe, die sie verdienen, und in Rotation reicht es für ein paar Monate ohne Langeweile. Ich kann zwar nicht aufhören zu kaufen, aber das liegt weniger daran, dass ich etwas vermisse, als daran, dass Empfehlungen, Zufallsfunde, Vorbands und nostalgische Geistesblitze wieder eine Dringlichkeit haben.
Empfehlungen sind nichts mehr, gegen das ich vom Algorithmus abgestumpft bin. Nichts, was egal ist, weil es eh auf Spotify ist. Vorschläge von anderen sind wieder potenzielle Bereicherungen, etwas, das verloren geht, wenn ich mir nicht den Aufwand mache, es in den Warenkorb zu werfen. Ich bin wieder deutlich bewusster mit meiner Musik, und es ist nichts mehr, was im Hintergrund läuft wie früher das Radio.
Für alle, die Tipps, Anleitungen und Empfehlungen zum digitalen Sammeln möchten, folgt bald ein Artikel dazu. Mein technischer Ansatz soll hier nicht der Punkt sein, der ist aus meinen Umständen entstanden. Die bequemste und günstigste Art, Musik zu hören aufzugeben, ergibt vermutlich für wenige Sinn. Der bewusstere, individuelle Umgang mit Musik, abseits von dem, was Spotify will, ist der Kernpunkt. Der lässt sich auf viele Arten, eben individuell, erreichen. Also nimm dir ab und zu ein paar Minuten, um dich zu fragen, ob es vielleicht alte Schätze gibt, die der Algorithmus verschluckt hat, oder Momente, in denen du bewusster mit Musik umgehen möchtest.
Wann hast du dich das letzte Mal hingesetzt, um ohne Ablenkung ein ganzes Album durchzuhören?