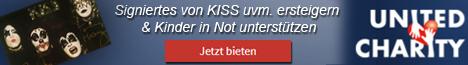Geschrieben von
dirk-bengt
Donnerstag, 08 November 2007 03:54
Pain Principle - Waiting for the Flies

Stil (Spielzeit): Neo-Thrash (39:20)
Label/Vertrieb (VÖ): Blind Prophecy Records / Soulfood (30.11.07)
Bewertung: 7 / 10
Link: www.painprinciple.org
Dies ist der dritte Versuch in 14 Jahren des Orlando-Vierers, sich in unsere harten Herzen und aus der Anonymität zu spielen. Gerne würde ich sagen, dass sie ihrem Ziel noch nie so nahe waren. Kann ich aber nicht, weil ich die ersten beiden Versuche nicht kenne. „Waiting For The Flies“ ist eine hübsch aggressive Kreuzung aus PANTERA–Thrash, Death und etwas Metalcore. Für zusätzliche Farbe sorgen diverse klassische Metal-Accessoires, die ich vor allem im Bereich der Leads ausmache, während die Band auch die Songstruktukturen als am klassischen Metal orientiert ausgibt. Nur eben mit anderen Tönen. Naja.
Angesichts der hier gebotenen Stilmischung ist von vornherein klar, dass es überwiegend flott zur Sache geht. Aber auch bunt? --- Die Scheibe liefert keinesfalls diverse Thrash- oder Death- oder Core-Stücke ab, sondern jedes Stück als solches ist ein Bastard. Das haben Sie mit den Heidelbergern R:I:P gemein, die statt Core-Elementen, Power-Metal als Katalysator für Death-Thrash einsetzen. Der tatsächliche Unterschied besteht aber weniger in der Differenz 'Core-Power, sondern darin, dass PAIN PRINCIPLE weit ruppiger zu Werke gehen. Das liegt nicht an dem höheren Härtegrad von Metalcore gegenüber Power-Metal. Im Gegenteil: auf dem Papier sollte 'Core mit Death-Thrash kombiniert, wohl eher runder laufen, homogener sein... Tut es hier im direkten Vergleich aber nicht.
„Ruppiger als …“ stell keine Wertung dar, weder positiv noch negativ, sondern bloß eine Beschreibung. Nun die Wertung: mir sind hier innerhalb der Lieder einfach zu viele Breaks untergebracht und Riffs verwurstet; das schmälert nicht nur den Wiedererkennungswert, sondern ist auf die Dauer einfach ein bisschen chaotisch. Nun kann das genau das künstlerische Ziel gewesen sein: Chaos zu generieren. Dann sag ich artig „Bravo“ zum Erreichen der artistischen Vorgabe, nörgele anschließend aber ungehemmt weiter, dass mir die dergleichen Ziele völlig Latte sind, weil ich nicht nur Abwechslungsreichtum, sondern auch Nachvollziehbarkeit als für den Hörgenuss hilfreich erachte. Halb so viele Tempo- und Akkordwechsel wären noch immer mehr als genug gewesen, Songs zu konstruieren, die beiden Ansprüchen genügen.
Dieser, aus meiner Konsumentensicht, nicht unbeträchtliche Mangel einer tendenziell guten Musik ist deshalb umso bedauerlicher, als P.P. phasenweise immer wieder vorführen, wie gut das klingen kann, wenn sie ein Stück mal ein bisschen laufen lassen. Denn sie haben ein gutes Händchen für ebenso feines wie bretthartes Riffing und Drumming in allen Geschwindigkeitsbereichen. Ähnliches gilt es auch vom Sänger zu vermelden; mangelnde Vielseitigkeit ist sicher nicht sein Problem. Hier wird in nur allen erdenklichen Schattierungen gebelfert, gegrowhlt und gebrüllt (und gelegentlich auch gesungen), dass es eine wahre Freude sein könnte. Wenn er denn einfach mit den Wechseln sparsamer umgegangen wäre.
Kontraste sind gut, weil notwendig; aus etwas Entfernung aber sieht eine Fläche kleiner schwarz-weißer Karos nun mal grau aus. Trotz vieler, vielmehr: wegen zu vieler Wechsel erzeugt man hier Längen, um nicht zu sagen phasenweise Langeweile. Schade. Potenz ohne Ende; gelingt es beim nächsten Mal, die leicht zu zügeln, steht Großes ins Haus. So bleibt nur das Vorhandensein geiler Riffs en masse; ungeschmälert geile Songs? Sorry.